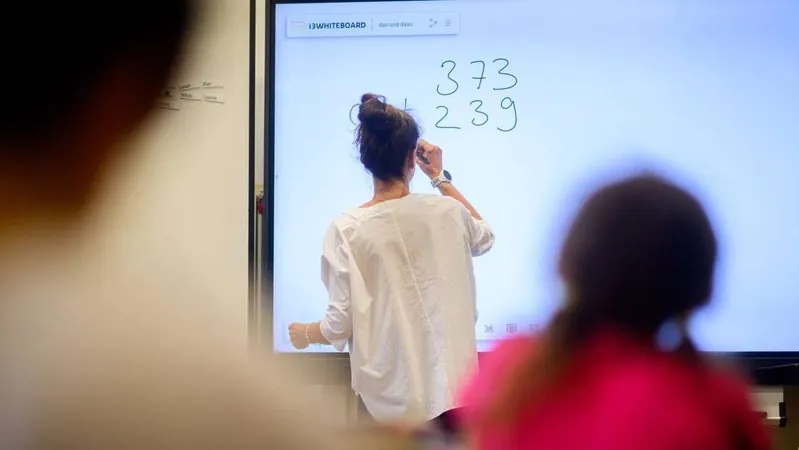
Demenz-Diagnose: Warum kluge Menschen besonders leiden
2025-03-20
Autor: Simon
Laut aktuellen Schätzungen leben in Deutschland rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz, einer Erkrankung, die zunehmend als Volkskrankheit wahrgenommen wird. Eine alarmierende Studie aus Rotterdam legt nahe, dass diese Diagnose für intellektuell begabte Menschen verheerendere Folgen haben könnte. Diese Erkenntnisse werfen neues Licht auf den Einfluss der sogenannten "kognitiven Reserve."
Die demografischen Daten zeigen, dass die Anzahl der Demenzkranken weltweit in den kommenden Jahrzehnten exponentiell ansteigen könnte. Forscher rechnen mit bis zu 2,8 Millionen Betroffenen in Deutschland bis 2050. Der gesellschaftliche Druck auf das Gesundheitssystem wird durch diese Zunahme weiter wachsen.
Eine neue Untersuchung des Erasmus University Medical Centre in Rotterdam bringt ans Licht, dass die Intelligenz einen trügerischen Schutz gegenüber Demenz bieten kann: Höhere Bildung korreliert mit einer verzögerten Diagnose. Bei intelligenten Menschen wird die Erkrankung oft erst spät erkannt, was bedeutet, dass sie sich häufig in einem fortgeschrittenen Stadium befinden, wenn die Diagnose endlich gestellt wird. Die durchschnittliche Lebenserwartung nach einer Demenz-Diagnose beträgt etwa 10,5 Jahre, allerdings zeigt die Studie, dass für jedes zusätzliche Bildungsjahr die zu erwartende Lebensdauer um etwa 2,5 Monate sinkt.
Wissenschaftler beschreiben dieses Phänomen als "Paradigma der kognitiven Reserve". Es geht davon aus, dass besser gebildete Menschen in der Lage sind, ein höheres Maß an neuronalen Schäden zu ertragen, bevor signifikante kognitive Beeinträchtigungen auftreten. Aber dieser Vorteil ist ein zweischneidiges Schwert: Ist die kognitive Reserve erschöpft, tritt Demenz oft in einem schwereren Stadium auf, was die Behandlung komplizierter macht.
Die Forschung legt zudem nahe, dass nicht nur Bildung, sondern auch soziale Interaktionen und geistige Stimulation entscheidend sind, um die kognitive Reserve im Alter zu erhalten. Maßnahmen zur Förderung von geistiger Aktivität könnten demnach nicht nur präventiv wirken, sondern auch den Verlauf von Demenzerkrankungen positiv beeinflussen.
Darüber hinaus wird erörtert, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen könnten. Bestimmte Gene, die für die neuronale Stabilität verantwortlich sind, können das Risiko von Alzheimer beeinflussen. Vergleichende Studien zeigen, dass Personen mit höherem Bildungsgrad tendenziell erst später an Alzheimer erkranken und besser mit der Erkrankung umgehen können.
Mit Blick auf die Zukunft ist es wichtig, das Bewusstsein für die Risiken und Vorteile der kognitiven Reserve zu schärfen. Bildung, soziale Kontakte und ein aktiver Lebensstil sollten stärker gefördert werden, um das kognitive Vermögen im Alter zu bewahren und vielleicht sogar dem unerbittlichen Voranschreiten von Demenz entgegenzuwirken. Die Forschung muss weiterhin intensiviert werden, um neue Therapieansätze zu entwickeln und das Verständnis über die komplexen Zusammenhänge zwischen Intelligenz und kognitiven Erkrankungen zu vertiefen.



 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)