
Der gewaltfreie Widerstand: Wie 15.000 Menschen die Pläne für das AKW Kaiseraugst scheitern ließen
2025-03-31
Autor: Laura
In der Schweiz sind außergewöhnliche Proteste selten – doch am 1. April 1975 ereignete sich ein unvergessliches Ereignis. An diesem Tag sollten die Bauarbeiten für das umstrittene Atomkraftwerk Kaiseraugst vorangetrieben werden, aber rund ein Dutzend Aktivisten stellte sich mit Entschlossenheit entgegen und blockierte die Zufahrten sowie schwere Baumaschinen.
Der damalige 28-jährige Peter Scholer war Mitbegründer der "Gewaltfreien Aktion Kaiseraugst (GAK)". Diese Gruppierung aus Jungsozialisten, Umweltschützern und Friedensaktivisten kämpfte für eine bessere Zukunft ohne Atomkraft. Ihr Aufruf zur Mobilisierung fand Gehör – binnen weniger Tage schlossen sich mehr als 15.000 Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten dem Protest an.
"Wir waren überrascht von der großen Unterstützung", erinnert sich Scholer. Mit Begeisterung kamen Familien, Arbeiter, Akademiker, Umweltaktivisten und sogar ehemalige Militärangehörige auf das Gelände, um gemeinsam gegen die atomare Bedrohung zu demonstrieren. Diesen Kurs konnten sie nicht mehr umkehren: "Dann war klar: Wir bleiben!", so Scholer weiter.
Die Polizei sah sich schnell überfordert: Der damalige Direktor des AKW Kaiseraugst, Ulrich Fischer, schildert, dass er zur Klärung des Konflikts versuchte, Kontakt aufzunehmen, jedoch auf ein unkooperatives Publikum stieß. „Sie lachten mich aus“, erinnert er sich enttäuscht.
Die Einsatzkräfte waren mit nur 280 Beamten und keiner Erfahrung mit solchen massiven Demonstrationen schlecht auf die Situation vorbereitet. Selbst Fischer war als Direktor machtlos: "Ich konnte selbst nichts mehr beitragen."
Die Besetzung dauerte elf Wochen und entwickelte sich zu einer Art solidarischem Zusammensein, das Scholer als "kleines Woodstock" bezeichnet. Zelte, Wohnwagen, Info- und Versorgungsstände sorgten für eine lebendige Atmosphäre.
Der Widerstand wurde von verschiedenen Seiten unterstützt, darunter auch Willi Ritschard, ein SP-Bundesrat, der drohte, seinen Rücktritt anzubieten, sollte das Militär gegen die Demonstranten vorgehen. Ritschard erkannte, dass die Besetzer nicht nur eine linke Randgruppe waren, sondern Repräsentanten der gesamten Bevölkerung, deren Stimme Gehör finden musste.
Nach intensiven Verhandlungen ließ sich der Bundesrat auf einen vorläufigen Baustopp des AKWs ein, und es wurde entschieden, keinen Zaun zu ziehen, um zukünftige Besetzungen nicht zu erschweren. Obwohl die Aktivisten gezwungen waren, ihre Besetzung zu beenden, wurde das Hauptziel – der Abbruch des AKW-Baus – erst zehn Jahre später erreicht.
Die Diskussion um Atomkraft erhitzte sich weiter, und nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 wurde klar, dass das geplante AKW in Kaiseraugst nicht realisierbar war. Die langfristigen Verzögerungen zeigten das Versagen der ursprünglichen Pläne auf. Die Schweizer Regierung entschied schließlich, das Projekt zu beerdigen, und entschädigte die gescheiterte Umsetzung mit 350 Millionen Franken.
Diese Geschichte ist nicht nur ein Beispiel für die Kraft des öffentlichen Protests, sondern auch eine wichtige Lektion darüber, wie die Stimme der Bürger selbst große Pläne und Visionen der Industrie beeinflussen kann – ein starkes Zeichen für zukünftige Generationen im Umgang mit umstrittenen Technologien.

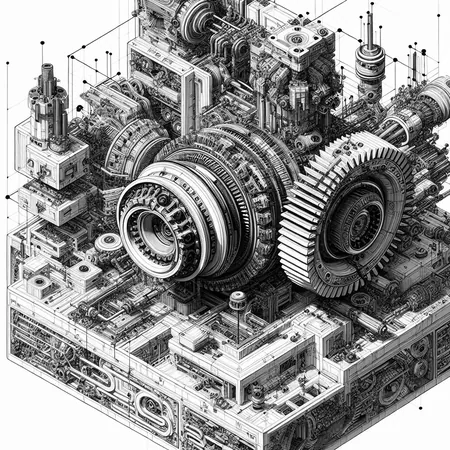
 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)